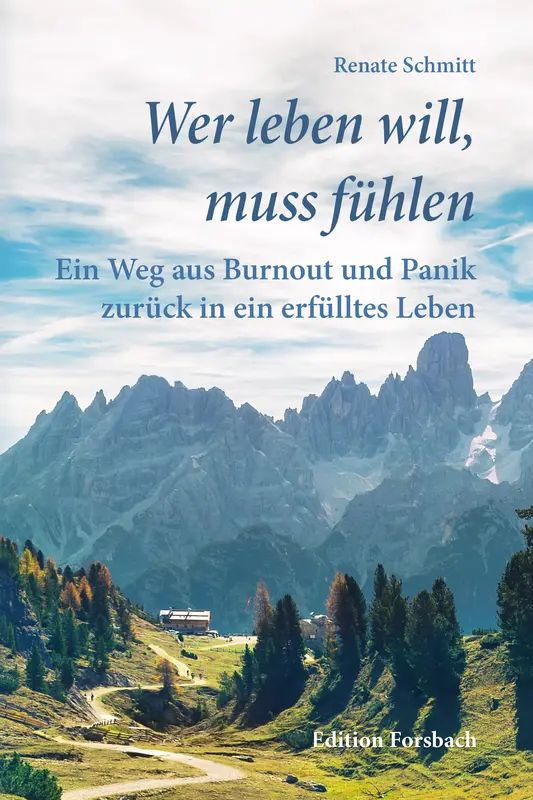Social Prescribing – Monet, Van Gogh oder Cézanne auf Rezept gegen Depression?
Veröffentlicht am: 14. September 2025

Ein Museumsbesuch auf Rezept, zur Stärkung der psychischen Gesundheit – mein Herz schlug schneller, als ich einen Artikel darüber in der Regionalausgabe unserer Zeitung entdeckte. Vom Begriff „Social Prescribing“ war dort die Rede, also die Verschreibung sozialer und kultureller Aktivitäten zur Gesundheitsförderung – in Großbritannien gehört das angeblich bereits zum staatlich finanzierten Gesundheitssystem NHS (National Health Service).
Was für eine tolle Sache, die hoffentlich auch in Deutschland bald eingeführt wird!
Der Artikel traf bei mir auch deshalb ins Schwarze, weil ich erst kürzlich ein halbtägiges „Wellness-Bad“ im Pariser Musée d´Orsay genommen und genau diese wohltuende Wirkung am eigenen Leib gespürt habe.
Warum soll ein Besuch in einem Kunstmuseum gesund für die Psyche sein?
Die Autorin des Artikels beschreibt genau das: sich von Schönheit berühren zu lassen und dabei ein Feuerwerk an Dopamin auslösen – als Mittel gegen Depression, Demenz und Einsamkeit. Ja genau: buchstäblich in Farbe zu baden, ist so wohltuend.
Wer jemals bewusst in die Aura der Kunst eingetaucht ist, weiß, dass dies wie eine Reise in eine andere Welt sein kann, aus der man oft spät und sehr erschöpft wieder auftaucht. Die Ermüdung mag zu einem Teil mit der sportlichen Ausdauerleistung zusammenhängen. Denn in einem riesigen Museumbau wie dem Louvre können schon so einige Kilometer zusammenkommen. Zu einem anderen Teil muss unser Nervensystem auch eine Fülle unbekannter Reize – Farbgemenge, Stimmengemurmel, verschwitzte Hemden - verarbeiten, was ebenfalls anstrengend sein kann.
Vor einem ausdrucksstarken Kunstwerk im Hier und Jetzt zu sein, sich auf dieses eine Gemälde zu fokussieren…, das ist eine der besten Achtsamkeitsübungen, die ich kenne – am besten mit Stöpseln im Ohr, um sich von den Besuchern abzuschirmen, die weniger fasziniert sind, z.B. pubertierende Schulklassen oder meist weibliche Duos, die laut schwatzend ihr Kulturpflichtprogramm zwischen Cappuccino und „Aperölchen“ durchführen.
Auch der positive soziale Faktor ist immens, wenn du dich mit einem anderen interessierten Betrachter über die Bedeutung eines Motivs austauschen kannst – vorausgesetzt die künstlerischen Schwingungen sind gleich (und NUR dann!).
Was mich als Kunstschaffende und Kunsttherapeutin persönlich begeistert und inspiriert: Ich kann an Modellen lernen (nicht nur technisch), denn hinter jedem Künstler steht ein bewegtes Leben. Ich erfahre: Wie hat ER damals gelebt? Wie lebe ICH heutzutage? Ich darf mich dankbar fühlen und glücklich schätzen. Welche Herausforderungen hatte er, und vor allem, wie hat er diese unter erschwerten Bedingungen bewältigt? Was kann ich daraus für mein eigenes Leben lernen?
Mit allen Punkten der Autorin war ich im Einklang, bis ich zu jenem Absatz kam, als sie die Museumstherapie mit der Kunsttherapie verglich. Leider untermauert sie darin einen sehr hartnäckigen Mythos: Museumstherapie erfordere kein künstlerisches Talent – „im Gegensatz zur Kunsttherapie“. Dem widerspreche ich auf das Heftigste. Denn bei der Kunsttherapie ist eine künstlerische Begabung genauso wenig nötig! Man muss dafür NICHT malen können - ganz im Gegenteil: Manchmal steht der Wirkung von Kunsttherapie ein zu großes Talent mit überhöhtem Anspruch sogar im Weg!
Als praktizierende Kunsttherapeutin in einer ambulanten Praxis für Psychotherapie regt sich hier mein Aufklärungsdrang: Kunsttherapie wird immer wieder maßlos unterschätzt. Und es werden unnötige Hürden durch Unwissen aufgebaut.
Kunsttherapie ist eine Kombination aus aktiver Kunstgestaltung und individueller Gesprächstherapie auf Augenhöhe und ohne Bewertung. Sie ist vor allem als Begleittherapie aus psychosomatischen und psychiatrischen Kliniken oder aus Reha-Kuren bekannt. Hier wird das therapeutische Malen meist im Rahmen eines Wochenplans als Angebot zur Gefühlsregulation und Entspannung angeboten.
Doch das ist nur EIN Vorteil von mehreren: Kunsttherapie kann zudem dabei helfen, traumatische Erfahrungen genauer anzuschauen und möglicherweise unangenehme Bilder im Kopf in erträglichere zu transformieren, sie neu zu erschaffen.
Zusätzlich zum therapeutischen Gespräch gibt es eine dritte Ebene, nämlich das gemalte Bild oder die entstandene Figur aus Ton. Dabei ist völlig unwichtig, ob eine Person künstlerisches Talent hat oder nicht. Im Gegenteil: zu viel Perfektion oder ein besonders schönes Bild malen zu wollen, kann sogar hinderlich sein.
Nicht selten erscheinen plötzlich verblüffende Dinge auf dem Papier, die für “Aha-Momente” sorgen und bedeutsame neue Erkenntnisse liefern und Ressourcen für den Prozess der Heilung oder einen Anstoß für längst überfällige Veränderungen aufzeigen können.
Kunsttherapie bedeutet nicht, „nur ein bisschen zur Entspannung“ zu malen. Sie gilt zunehmend als eine wissenschaftlich forschungsrelevante psychotherapeutische Methode, z.B. bei leichter bis mittelgradiger Depression oder Erschöpfungsdepression (Burnout), Angststörungen, bei Körpersymptomen ohne organischen Befund (z.B. diffuse Schmerzen, Schwindel, Kopfschmerzen) und in Lebenskrisen (Trauer, Trennungen, Zielfindung, Midlife-Crisis u.a.).
Fazit: „Social Prescribing“ sollte unbedingt auch in Deutschland eingeführt werden. Und: Bei der Kunsttherapie bedarf es mehr Aufklärung darüber, wie wertvoll und heilsam sie sein kann. Man muss definitiv NICHT KÜNSTLERISCH BEGABT sein, um eine Kunsttherapie in Anspruch nehmen zu können! Es geht dabei um kein zu bewertendes Endprodukt (wie früher in der Schule), sondern um den wertungsfreien Prozess des Malens, um Emotionen und Erkenntnisse, die sich während des Gestaltens ergeben. Die Erfahrung aus meiner Praxis zeigt: Sehr häufig gelangen Klienten über ihre Bilder sogar schneller an ihre „Knackthemen“ als bei einem reinen psychotherapeutischen Gespräch. Ausprobieren lohnt sich.